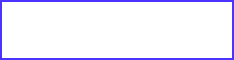Thüringer Pensionsbericht 2023
|
BEHÖRDEN-ABO mit drei Ratgebern für nur 22,50 Euro: Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht (Bund/Länder) sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Alle drei Ratgeber sind übersichtlich gegliedert und erläutern auch komplizierte Sachverhalte verständlich und kompakt (auch geeignet für Beamtinnen und Beamte sowie Tarifkräfte vom Freistaat Thüringen).. Das BEHÖRDEN-ABO >>> kann hier bestellt werden
|
PDF-SERVICE: 10 Bücher bzw. eBooks zu wichtigen Themen für Beamte und dem Öff. Dienst Zum Komplettpreis von 15 Euro im Jahr können Sie zehn Bücher als eBook herunterladen, auch für Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte vom Freistaat Thüringen geeignet: Themen der Bücher sind: Rund ums Geld im öffentlichen Dienst, Beamtenrecht, Besoldung, Beihilferecht, Beamtenversorgungsrecht, Frauen im öffentlichen Dienst, Nebentätigkeitsrecht sowie Berufseinstieg im öffentlichen. Dienst. Die eBooks kann man herunterladen, ausdrucken und lesen >>>mehr Informationen |
Aktualisierung des Berichts der Landesregierung zur Entwicklung der Versorgungsausgaben für die Beamten, Richter und anderen Versorgungsempfänger 1 des Freistaats Thüringen (Thüringer Pensionsbericht 2023)
Bericht der Landesregierung zum Beschluss des Thüringer Landtags vom 15. Dezember 2022 (Drucksache 7/6926)
I. Einleitung
Den Personalkosten der Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Freistaats Thüringen kommt eine erhebliche Relevanz für den Landeshaushalt zu. Zudem stehen sie regelmäßig im Fokus der Öffentlichkeit. Während in der Vergangenheit vor allem die Personalausgaben der aktiven Beschäftigten in den Blick genommen wurden, rückt auch die Entwicklung und Finanzierung der Ausgaben der Beamtenversorgung immer weiter in den Vordergrund. Der Freistaat Thüringen nähert sich diesbezüglich den Verhältnissen in den alten Bundesländern an.
Vor diesem Hintergrund wurde auf Beschluss des Thüringer Landtags vom 8. Juli 2011 erstmalig Ende des Jahres 2012 ein Pensionsbericht durch die Landesregierung vorgelegt (Drucksache 5/5342). In der 6. Legislaturperiode wurden dessen Prognosen überprüft und fortgeschrieben (Drucksache 6/1548) bzw. aktualisiert (Drucksache 6/4030).
Der Thüringer Landtag hat nunmehr in seiner 97. Sitzung vom 15. Dezember 2022 aufgrund des Antrags der Fraktion der CDU (Drucksache 7/5330) im Hinblick auf die steigenden Versorgungsausgaben und zu erwartenden Ruhestandseintritte in den kommenden Jahren folgenden Beschluss (Drucksache 7/6926) gefasst:
„Der Landtag beschließt:
1. Die Landesregierung wird aufgefordert, den am 10. Dezember 2012 erstmalig vorgelegten Pensionsbericht (Drucksache 5/5342), welcher im Jahr 2015 fortgeschrieben und 2017 aktualisiert wurde, auf den aktuellen Stand zu bringen, fortzuschreiben und dem Landtag spätestens bis zum 30. April 2023 vorzulegen.
1
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Übersichtlichkeit des Berichts wird auf die Verwendung der Paarformen verzichtet und stattdessen das generische Maskulinum verwendet.
2
2.
Der Pensionsbericht soll Aussagen und Bewertungen über die voraussichtliche Entwicklung der Pensionsausgaben in den kommenden 20 Jahren für die Beamten, Richter und andere Versorgungsempfänger im Landesbereich enthalten.“
Der vorliegende Bericht greift diese Punkte auf und erfüllt damit den vom Thüringer Landtag formulierten Auftrag.
Seit der letzten Aktualisierung des Pensionsberichts ergaben sich bedeutende personalpolitische Entscheidungen sowie Änderungen im Thüringer Besoldungs- und Beamtenversorgungsrecht, die sich auf die Entwicklung der Versorgungsausgaben auswirkten. Insbesondere folgende Aspekte wären hierbei zu benennen:
- Mit Beschluss der Landesregierung vom 28. Februar 2017 zum Personalentwicklungskonzept 2025 wurde u. a. das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport beauftragt, die Verbeamtung von bereits eingestellten und neu einzustellenden Lehrern vorzunehmen, soweit die beamten-, laufbahn- und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt waren. In Folge dessen wurden ab 1. Oktober 2017 ca. 2.000 bereits vorhandene Lehrer verbeamtet sowie seitdem neu eingestellte Lehrer ebenfalls verbeamtet.
- Durch das Thüringer Gesetz zur Steigerung der Attraktivität des Berufs des Regelschullehrers
2 vom 9. Juli 2019 wurden endgültig besoldungsrechtlich die Ämter der Regelschullehrer von Besoldungsgruppe A 12 auf Besoldungsgruppe A 13 angehoben.
- Durch das Thüringer Gesetz zur Änderung des Thüringer Besoldungsgesetzes
3 vom 21. Dezember 2020 wurde zum 1. August 2021 das Amt des Grundschullehrers von der Besoldungsgruppe A 12 in die Besoldungsgruppe A 13 angehoben.
Durch diese personellen Maßnahmen und besoldungsrechtlichen Änderungen erhöhte sich nicht nur die Anzahl der Beamten, sondern auch die künftigen Versorgungsausgaben in einer für den Bericht ausgabenrelevanten Beamtengruppe.
Ferner hat das Bundesverfassungsgericht mit seinen Beschlüssen vom 4. Mai 2020 die Bezüge der Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppen R 1 und R 2 des Landes Berlin 4 und der Besoldungsgruppe R 2 des Landes Nordrhein-Westfalen 5 für bestimmte Zeiträume mit Art. 33 Abs. 5 des Grundgesetzes für unvereinbar erklärt. Auf der Grundlage dieser Beschlüsse wurde die
2
GVBl. S. 286.
3
GVBl. S. 655.
4
BVerfG, Beschl. v. 4. Mai 2020, Az. 2 BvL 4/18 – juris.
5
BVerfG, Beschl. v. 4. Mai 2020, Az. 2 BvL 6/17, 2 BvL 7/17, 2 BvL 8/17 – juris.
3
Alimentation in Thüringen geprüft und für die Jahre 2020 und 2021 durch das Thüringer Gesetz zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation sowie über die Gewährung einer Anerkennungsleistung für ehemalige angestellte Professoren neuen Rechts 6 vom 2. November 2021 sowie für das Jahr 2022 durch das Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2022 und zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften
7 vom 15. November 2022 so gestaltet, dass sie den konkretisierten Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts entsprechen. Neben direkten Auswirkungen für die aktiven Beamten sind diese besoldungsrechtlichen Regelungen gemäß § 4 Abs. 1 ThürBeamtVG auch auf die Versorgungsempfänger zu übertragen.
Vor dem Hintergrund dieser und weiterer personalpolitischer Entscheidungen sowie besoldungs- und versorgungsrechtlicher Änderungen konnte der letzte Pensionsbericht nicht lediglich fortgeschrieben bzw. aktualisiert werden. Vielmehr mussten die den Berechnungen zugrunde liegenden Annahmen für den vorliegenden Bericht teilweise grundlegend überarbeitet werden.
Im Abschnitt II. werden zunächst die Berechnungsgrundlagen, die Berechnungsmethodik und die für die Berechnung getroffenen Annahmen dargestellt. Der Abschnitt III. enthält sodann das Rechenergebnis. Der Abschnitt IV. enthält eine Bewertung.
II. Berechnungsgrundlagen, Berechnungsmethodik und für die Berechnung getroffene Annahmen
Der vorliegende Bericht basiert auf individuellen Datensätzen für jeden Thüringer Beamten bzw. Richter und Empfänger von Versorgungsbezügen. Diese Daten wurden dem Thüringer Finanzministerium (TFM) vom Thüringer Landesamt für Finanzen (TLF) in anonymisierter Form für die Berechnungen übermittelt. Aufgrund dieser Daten und weiterer Informationen wurden für diesen Bericht Annahmen getroffen und die Berechnungen durchgeführt. Diese sowie die Berechnungsmethodik werden im Folgenden dargestellt.
1. Vorhandene Empfänger von Versorgungsbezügen
Betrachtet wurden für diesen Bericht die Daten für die vorhandenen Ruhegehaltsempfänger sowie von Witwen und Waisen.
a) Ruhegehaltsempfänger
Für die zum 1. Januar 2023 vorhandenen Ruhegehaltsempfänger einschließlich der ehemaligen Mitglieder der Landesregierung, die Ruhegehalt nach dem
6
GVBl. S. 547.
7
GVBl. S. 437.
4
Thüringer Ministergesetz beziehen, hat das TLF für jeden einzelnen anonymisiert folgende Daten übermittelt:
•
Geburtsdatum,
•
Geschlecht,
•
Familienstand,
•
Besoldungsgruppe, aus der sich die Versorgungsbezüge errechnen,
•
Höhe der Versorgungsbezüge.
Dabei wurden die Ruhegehaltsempfänger differenziert nach solchen, die aufgrund des Erreichens der Regelaltersgrenze (§§ 25 Abs. 2 Satz 1, 25 Abs. 3 ThürBG), der Antragsaltersgrenze (§ 26 Abs. 1 ThürBG), einer besonderen Altersgrenze nach §§ 106, 108 ThürBG, wegen Dienstunfähigkeit oder aus sonstigen Gründen in den Ruhestand getreten sind.
Dem jeweiligen Ruhegehaltsempfänger wurde anhand seines Geburtsdatums seine aktuelle Lebenserwartung zugeordnet. Hierzu wurde die „Sterbetafel 2019/2021 für Ostdeutschland (ohne Berlin) nach Geschlecht“ des Bundesamts für Statistik 8 verwendet und anhand der Lebenserwartung jedem Empfänger von Ruhegehalt sein fiktives Sterbedatum zugeordnet.
Je nach individueller Lebenserwartung wurde danach das Ruhegehalt jedes einzelnen Ruhegehaltsempfängers den Ausgaben für die Jahre 2023 bis 2042 in Jahresscheiben zugeordnet. Für das Jahr des fiktiven Versterbens – soweit dies in den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2042 (nachfolgend: Berichtszeitraum) fällt – wurde das Ruhegehalt nur zeitanteilig berücksichtigt.
Beispiel:
Ein am 21. November 1955 geborener lediger männlicher Empfänger von Ruhegehalt erhält ein monatliches Ruhegehalt von 2.601,92 Euro. Ausweislich der Sterbetafeln wird ihm heute eine Lebenserwartung von 15,818 Jahren zugeordnet, woraus sich mit dem 26. Oktober 2038 sein fiktives Sterbedatum errechnet. Daher wird seine Versorgung für diesen Bericht für die Jahre 2023 bis 2037 (15 Jahre) jeweils mit dem vollen Betrag und für das Jahr 2038 lediglich mit dem entsprechenden Teilbetrag bis zum fiktiven Sterbedatum (2.129,53 Euro) berücksichtigt und im Anschluss zur Ermittlung des Jahresbetrages mit Zwölf multipliziert. Ab dem Jahr 2039 ist dieser Versorgungsempfänger für den Pensionsbericht nicht mehr zu berücksichtigen.
Für das Jahr des Versterbens wurde jeweils das Sterbegeld für Ruhestandsbeamte (§ 47 Abs. 1 Satz 4 ThürBeamtVG) ermittelt. Sterbegeld erhalten beim Tod eines Ruhestandsbeamten die Personen, die nachweislich die Kosten der letzten Krankheit oder der Bestattung des Ruhestandsbeamten getragen 8
Zu finden im Internetauftritt des Amtes: www.destatis.de.
5
haben (§ 47 Abs. 1 Sätze 1 und 4 ThürBeamtVG). Bei Ruhestandsbeamten beträgt das Sterbegeld dem Zweifachen des Ruhegehalts (§ 47 Abs. 1 Sätze 2 und 4 ThürBeamtVG). Der so jeweils errechnete Betrag wurde in der entsprechenden Jahresscheibe berücksichtigt.
Ab dem Sterbezeitpunkt wurde zudem je verstorbenen verheirateten männlichen Ruhegehaltsempfänger ein Witwengeld berücksichtigt. Das Witwengeld beträgt nach § 49 Abs. 1 Satz 1 ThürBeamtVG 55 vom Hundert des Ruhegehalts, das der Verstorbene erhalten hat. Abweichend hiervon beträgt das Witwengeld 60 vom Hundert des Ruhegehalts, das der Verstorbene erhalten hat, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde und mindestens ein Ehegatte zu diesem Zeitpunkt das 40. Lebensjahr vollendet hatte (§ 49 Abs. 2 Satz 1 ThürBeamtVG). Unter Berücksichtigung dieser Ausnahmevorschrift wurde für diesen Bericht ein für das Witwengeld gewichteter Satz in Höhe von 58 vom Hundert bei den vorhandenen Ruhegehaltsempfängern zugrunde gelegt. In dieser Gewichtung wurden auch die Kürzungen nach § 49 Abs. 3 ThürBeamtVG berücksichtigt.
Hinsichtlich des Alters der Witwe wurde ein Altersunterschied zu Gunsten der Witwe von 4,07 Jahren angenommen. Diesem liegt der statistisch ermittelte Altersunterschied der Paare in Lebensgemeinschaften in Deutschland bis zum Jahr 2021 zugrunde. Danach weisen Paare folgende Altersunterschiede auf:
Aus dieser Verteilung errechnet sich ein Durchschnitt von 4,76 Jahren und ein Median von 3,38 Jahren. Der Mittelwert dieser beiden Werte beträgt 4,07 Jahre, welcher den Berechnungen zugrunde gelegt wurde. Für die jeweilige Witwe wurde danach anhand des Alters ihres Ehegatten und ihrer individuellen Lebenserwartung nach der vorbenannten Sterbetafel ebenfalls ihr fiktives Sterbedatum ermittelt und die Bezugsdauer des Witwengeldes bis zu diesem Zeitpunkt begrenzt. Die entsprechenden Werte wurden in die Jahresscheiben des Berichtszeitraums aufgenommen. Durch die Annahme des oben genannten Wertes wurden zudem auch die Fälle mitberücksichtigt, wonach entgegen der statistischen Annahmen eine Ruhestandsbeamtin vor ihrem Ehegatten verstirbt.
Bezüglich der Versorgungsausgaben für die Ruhegehaltsempfänger, die einer besonderen Altersgrenze nach §§ 106, 108 ThürBG unterliegen (Polizei- und Justizvollzugsdienst), ist zusätzlich zu beachten, dass die derzeitigen 6
Versorgungsausgaben teilweise eine vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltsatzes gemäß § 22 ThürBeamtVG enthalten. Diese vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes dient bei Ruhestandsbeamten, die auch über Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung verfügen, dem vorübergehenden finanziellen Ausgleich bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung, da diese Rentenansprüche erst dann zur Auszahlung gelangen.
Nach § 22 Abs. 2 Satz 1 ThürBeamtVG beträgt die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes 0,95667 vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge für je zwölf Kalendermonate der für die Erfüllung der Wartezeit nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 ThürBeamtVG anrechnungsfähigen Pflichtbeitragszeiten, soweit sie vor Begründung des Beamtenverhältnisses zurückgelegt wurden und nicht als ruhegehaltfähig berücksichtigt sind.
Da die anteiligen Beträge des Ruhegehalts, die sich aus dieser individuellen vorübergehenden Erhöhung des Ruhegehaltssatzes ergeben, in den Recherchen des TLF nicht gesondert ausgewiesen sind, wurden sie für diesen Bericht fiktiv anhand der je nach Lebensalter möglichen Vordienstzeiten mit Rentenanspruch berechnet und ab dem Zeitpunkt des Erreichens der Regelaltersgrenze nicht mehr in die individuellen Versorgungskosten eingerechnet. Der fiktiven Berechnung wurden folgende Parameter zugrunde gelegt:
b) Witwen
Hinsichtlich der zum 1. Januar 2023 vorhandenen Empfänger von Witwengeld (§ 48 ff. ThürBeamtVG) wurde ebenfalls anhand ihres individuellen Lebensalters und ihrer sich daraus ableitenden Lebenserwartung jeweils ein fiktives Sterbedatum ermittelt und der Bezug des Witwengeldes bis zu diesem Zeitpunkt begrenzt. Die Zahlungen wurden den Jahresscheiben des Berichtszeitraums zugeordnet. Im Übrigen wurde bei diesen wie unter Punkt a) beschrieben verfahren. 7
c) Waisengeld
Die Hinterbliebenenversorgung in Form von Waisengeld (§ 52 ff. ThürBeamtVG) und Unfallwaisengeld (§ 55 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ThürBeamtVG) betrifft lediglich 174 Zahlfälle. Aufgrund der fehlenden Signifikanz dieser Werte für diesen Bericht wurden die entsprechenden Beträge für den Berichtszeitraum jeweils ohne demografische Betrachtung fortgeschrieben. Damit wurde einerseits der Einstellung der Zahlung des Waisengeldes mit Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach Berufsausbildung (§ 61 ThürBeamtVG) Rechnung getragen. Andererseits ist davon auszugehen, dass aufgrund des Versterbens jüngerer Beamter mit Kindern neue Waisengeldzahlungen hinzutreten werden, die nicht detailliert prognostiziert werden können.
2. Aktive Beamte und Richter, die bis zum Jahr 2042 in den Ruhestand treten
Des Weiteren wurden die aktiven Beamten und Richter, die bis zum Jahr 2042 in den Ruhestand treten, in die Betrachtung einbezogen. Das TLF hat dem TFM hierzu für jeden einzelnen Beamten und Richter anonymisiert folgende Daten übermittelt:
Diese Klassifizierung war notwendig, da sich die im Folgenden dargelegten Unterschiede bei der Ermittlung des Ruhegehalts ergeben. Die Höhe des Ruhegehalts bestimmt sich im Wesentlichen nach den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen (§ 12 ThürBeamtVG) und der ruhegehaltfähigen Dienstzeit (§§ 13 ff. ThürBeamtVG). Hierzu wurden im Einzelnen folgende Annahmen getroffen:
a) sonstige Beamte und Richter
Sonstige Beamte im Sinne dieses Berichts sind alle Beamten, soweit sie nicht dem Lehrerbereich oder dem Polizei- bzw. Justizvollzugsdienst zuzuordnen 8 sind. Anhand des Geburtsdatums wurde für jeden Beamten und Richter die nach § 25 Abs. 2 Satz 1 ThürBG maßgebliche Regelaltersgrenze, mithin die Vollendung des 67. Lebensjahres, und dadurch das Datum des Ruhestandseintritts ermittelt. Für die vor dem 1. Januar 1964 geborenen Beamten und Richter wurden die Altersgrenzen des § 25 Abs. 2 ThürBG berücksichtigt.
Zur Ermittlung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit nach § 13 ThürBeamtVG, über die grundsätzlich erst bei Eintritt in den Ruhestand entschieden wird, wurde daher im Grundsatz das Jubiläumsdienstalter zugrunde gelegt, da dieses für eine Prognose geeignet ist, die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach §§ 13 Abs. 1, 15 und 16 ThürBeamtVG sachgerecht abzubilden. Für die Beamten des höheren Dienstes und für die Richter wurde zusätzlich für die Hochschulausbildung eine dreijährige Studienzeit nach § 18 Abs. 1 Satz 1 ThürBeamtVG berücksichtigt. Hiervon abweichend wurde mit Blick auf das Personal an Hochschulen für die Beamten der Besoldungsordnungen W und C neben der vorbenannten dreijährigen Studienzeit die Promotion mit zwei Jahren (§ 78 Abs. 2 Satz 2 ThürBeamtVG), die Habilitation mit drei Jahren (§ 78 Abs. 2 Satz 3 ThürBeamtVG) sowie zwei weitere Jahre nach § 78 Abs. 2 Satz 4 ThürBeamtVG den Berechnungen zugrunde gelegt. Damit ergeben sich für diese Beamten sieben weitere Jahre als ruhegehaltfähige Dienstzeit.
Mit Blick auf § 19 Abs. 1 ThürBeamtVG wurde bei den Beamten und Richtern aus dem Beitrittsgebiet die oben ermittelte ruhegehaltfähige Dienstzeit auf Zeiten nach dem 3. Oktober 1990 beschränkt.
Gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 ThürBeamtVG errechnen sich die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus dem Grundgehalt, das dem Beamten bzw. Richter zuletzt zugestanden hat. Neben der Zugrundelegung des Endgrundgehalts bei den Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A und den Besoldungsgruppen R 1 und R 2 war deshalb zur sachgerechten Ermittlung der Versorgungsausgaben ferner eine Beförderungsprognose anzustrengen. Für die Besoldungsordnungen B, W und C wurde danach das derzeit bekleidete Amt als das für den Ruhestandseintritt maßgebliche Amt betrachtet und bei den jeweiligen Beamten entsprechend hinterlegt. Gleiches gilt für die Besoldungsordnung R, wobei für mögliche Beförderungen in ein Amt oberhalb der Besoldungsgruppe R 2 für alle derzeitigen Richter der Besoldungsgruppe R 2 das maßgebliche Grundgehalt pauschaliert um 1 Prozent erhöht wurde. In der Besoldungsordnung A wurde für die Ämter der Besoldungsgruppen A 6 bis A 8 die Besoldungsgruppe A 8 als Amt bei Ruhestandseintritt angenommen. Für mögliche Beförderungen von der Besoldungsgruppe A 8 nach A 9 wurde für alle derzeitigen Beamten der Besoldungsgruppe A 8 das Grundgehalt pauschaliert um 3 Prozent erhöht. Beamte der Besoldungsgruppe A 9 mD verbleiben für die Betrachtung in ihrem Amt. Für die Besoldungsgruppen A 9 gD bis A 11 wurde die Besoldungsgruppe A 11 als Amt bei Ruhestandseintritt zugrunde gelegt. Für mögliche Beförderungen nach A 12 wurde für die Beamten der Besoldungsgruppe A 11 das Grundgehalt pauschaliert um 5 Prozent erhöht. Beamte der Besoldungsgruppen A 12 und A 13 gD verbleiben in ihrem Amt. Für 9 Beamte der Besoldungsgruppe A 13 hD wird das Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe A 14 zugrunde gelegt. Beamte der Besoldungsgruppe A 14 bis A 16 verbleiben in ihrem jeweiligen Amt. Für mögliche Beförderungen in Ämter der Besoldungsordnung B wird das Grundgehalt der derzeitigen Beamten der Besoldungsgruppe A 16 pauschaliert um 1 Prozent erhöht. Schlussendlich wurde für die Beamten oder Richter, die innerhalb der nächsten fünf Jahre in den Ruhestand treten, keine Beförderung, sondern das aktuelle Amt für die Berechnungen zugrunde gelegt.
Die nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeamtVG ruhegehaltfähige allgemeine Zulage nach Abschnitt II Nr. 7 der Vorbemerkungen zu den Thüringer Besoldungsordnungen A und B und Nr. 2 der Thüringer Besoldungsordnung R wurde den Beamten und Richtern entsprechend ihrer Besoldungsgruppe zugeordnet.
Der nach § 12 Abs. 1 Nr. 7 ThürBeamtVG ruhegehaltfähige Familienzuschlag der Stufe 1 wurde bei Beamten und Richtern berücksichtigt, die verheiratet oder in eingetragener Lebenspartnerschaft sind.
Für verheiratete Beamtinnen und Richterinnen sowie unverheiratete Beamtinnen und Richterinnen, die wegen der Berücksichtigung eines Kindes ebenfalls den Familienzuschlag der Stufe 1 erhalten, wurde der Kindererziehungszuschlag (§ 65 i. V. m. der Anlage zum ThürBeamtVG) pauschaliert in Höhe von insgesamt 158,76 Euro (= 1,5 Kinder x 36 Monate x 2,94 Euro) in die Berechnung des Ruhegehaltes einbezogen.
Das so errechnete Ruhegehalt wurde bei den Beamten und Richtern ab dem individuellen Ruhestandseintritt in den Jahresscheiben für die Jahre 2023 bis 2042, im Jahr des Ruhestandseintritts lediglich zeitanteilig, berücksichtigt.
Auch bei den aktiven Beamten und Richtern war ein Versterben vor oder nach Ruhestandseintritt zu berücksichtigen. Hierbei wurde die Sterbetafel des Bundesamtes für Statistik 9 angewandt. Aus dieser wurde die Wahrscheinlichkeit für ein Versterben zwischen dem 21. und 67. Lebensjahr mit 17,65813 Prozent ermittelt. Mit Hilfe von Zufallszahlen wurde eine entsprechende Anzahl von Beamten und Richtern ausgewählt, für die ein fiktives Versterben simuliert wurde.
Für den Fall, dass nach der Simulation der betroffene Beamte oder Richter nach seinem oben ermittelten Ruhestandseintritt im Berichtszeitraum verstirbt, wurde die entsprechende Ruhegehaltszahlung in den Jahresscheiben ab dem Todeszeitpunkt nicht mehr berücksichtigt. Stattdessen wurde, falls der Beamte oder Richter verheiratet war oder in eingetragener Lebenspartnerschaft lebte, ein Witwengeld nach §§ 48 ff. ThürBeamtVG in Höhe von 55 Prozent des Ruhegehalts berücksichtigt. Soweit die verstorbene Person männlich war, wurde pauschaliert ein Kinderzuschlag zum Witwengeld nach § 67 Abs. 1 9
Zu finden im Internetauftritt des Amtes: www.destatis.de. 10
ThürBeamtVG dem Witwengeld hinzugerechnet. Ein vorzeitiges Versterben der Witwe im Berichtszeitraum wurde aufgrund der Tatsache, dass sich die Witwe bei diesen Beamten oder Richter anders als bei den oben dargestellten Ruhegehaltsempfängern nicht unbedingt im fortgeschrittenen Alter befinden muss, nicht berücksichtigt. Ein Sterbegeld nach § 47 ThürBeamtVG wurde wie bei den versterbenden Ruhegehaltsempfängern im Jahr des Versterbens hinzugerechnet.
Verstirbt der betroffene Beamte oder Richter nach der oben dargestellten Simulation vor Eintritt in den Ruhestand, so wurde hinsichtlich der Berechnung der Höhe des Witwengeldes die ruhegehaltfähige Dienstzeit des Beamten oder Richters bis zu seinem Versterben ermittelt und gegebenenfalls die Zurechnungszeit des § 20 Abs. 1 ThürBeamtVG hinzugerechnet. Ist danach der Beamte oder Richter vor Vollendung des 62. Lebensjahres verstorben, wird die Zeit vom Todeszeitpunkt bis zum (fiktiven) Ablauf des Monats der Vollendung des 62. Lebensjahres für die Berechnung des Ruhegehalts zu zwei Dritteln hinzugerechnet. Verstirbt der Beamte oder Richter vor Vollendung des 62. Lebensjahrs ist ferner der Versorgungsabschlag des § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ThürBeamtVG pauschaliert mit 10,8 Prozent, ansonsten mit 5,4 Prozent zum Abzug gebracht worden. Der Kinderzuschlag zum Witwengeld nach § 67 ThürBeamtVG war gegebenenfalls wie oben dargestellt dem Witwengeld hinzuzurechnen. Das so ermittelte Witwengeld wurde auf die entsprechenden Jahresscheiben des Berichtszeitraums verteilt. Ein Sterbegeld nach § 47 ThürBeamtVG wurde auch für diese aktiven Beamten und Richter im Jahr des Versterbens als einmalige Ausgabe berücksichtigt.
Ferner musste der vorzeitige Ruhestandseintritt, mithin eine Versetzung in den Ruhestand auf Antrag nach § 26 Abs. 1 ThürBG, Berücksichtigung finden. Nach Information des TLF beträgt die Quote der dies in Anspruch nehmenden Beamten und Richter (außer Lehrer) derzeit 56,36 Prozent. Um diese berechnungserhebliche Tatsache für diesen Bericht simulieren zu können, musste auch an dieser Stelle eine Zufallsauswahl der entsprechenden Beamten und Richter vorgenommen werden. In Betracht kamen hierfür allerdings nur diejenigen Personen, die aufgrund der oben dargelegten Simulation zum Versterben nicht im Berichtszeitraum bzw. nicht vor Ruhestandseintritt fiktiv versterben. Aus dieser Menge der Beamten und Richter wurde durch Zufallszahlen eine die oben genannte Quote erreichende Anzahl von Beamten und Richtern ausgewählt. Für diese Personen wurde pauschaliert ein um drei Jahre vorzeitiger Ruhestand unterstellt. Damit war für diese die ruhegehaltfähige Dienstzeit um drei Jahre zu vermindern und zugleich das so errechnete Ruhegehalt um den Versorgungsabschlag des § 21 Abs. 2 Nr. 1 ThürBeamtVG zu kürzen. Die so ermittelten Ruhegehälter wurden bei den jeweiligen Personen um die drei Jahre in den jeweiligen Jahresscheiben zeitlich vorgezogen.
Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung werden nur anteilig als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt. Zur Abbildung in diesem Bericht wurde daher auf 11 den sich aus der aktuellen Besoldungsstruktur ergebenden Teilzeitfaktor zurückgegriffen, welcher einem Wert von 0,98 Einheiten der Vollbeschäftigung entspricht. Dieser wurde auf die nach den oben genannten Maßgaben ermittelte ruhegehaltfähige Dienstzeit angewendet.
Für die Mitglieder der derzeitigen Landesregierung wurden die Versorgungsausgaben nach den jeweils einschlägigen Regelungen des Thüringer Ministergesetzes berechnet, wobei der 30. November 2024 als Ende der derzeitigen Legislatur unterstellt wurde. Für künftige Landesregierungen im Berichtszeitraum können allerdings keine Ausgaben verlässlich prognostiziert werden, da insbesondere Alter und zukünftige Amtszeit nicht bekannt sind.
b) Lehrer
Abweichend zu den unter a) gemachten Ausführungen waren für die Lehrer andere Parameter zu unterstellen, die im Folgenden dargestellt werden.
Mit Blick auf die ruhegehaltfähige Dienstzeit ist zu beachten, dass die zuvor tarifbeschäftigen Lehrer des Beitrittsgebietes in zwei Kampagnen (1. Oktober 2001 und 1. Oktober 2017) verbeamtet wurden. Diese konnten anhand einer vom TLF übersandten Kennung aus den Datensätzen ermittelt werden. Für diese Lehrer wurden einheitlich fünf Jahre als ruhegehaltfähige Vordienstzeit nach § 16 Abs. 1 ThürBeamtVG berücksichtigt, so dass sich für diese die ruhegehaltfähige Dienstzeit ab dem 1. Oktober 1996 bzw. 2012 errechnete. Alle anderen Lehrer wurden hingegen mit ihrem Jubiläumsdienstalter berücksichtigt.
Eine dreijährige Studienzeit nach § 18 Abs. 1 Satz 1 ThürBeamtVG wurde bei den Lehrern hinzugerechnet, die aus dem früheren Bundesgebiet stammen sowie bei allen Lehrern, die erstmals im Beitrittsgebiet ernannt wurden und nach dem 1. Juni 1972 geboren wurden. Denn nur bei Letzteren ist pauschaliert sichergestellt, dass sie ihre Ausbildung erst nach dem 3. Oktober 1990 begonnen haben.
Bezüglich des bekleideten Amtes bei Ruhestandseintritt wurde bei jedem Lehrer, Fachleiter bzw. Inhaber einer Schul- bzw. Seminarleitungsfunktion seine derzeitige Besoldungsgruppe zugrunde gelegt. Zur Abbildung von künftigen Beförderungen in Leitungsämtern wurde das Endgrundgehalt der Beamten der Besoldungsgruppe A 16 pauschal um 0,25 Prozent erhöht.
Nach Angaben des TLF nutzen hingegen derzeit 74,66 Prozent der Lehrer die Möglichkeit des Antragsruhestands. Die unter a) dargestellten Berechnungen hierzu wurden entsprechend dieses Wertes durchgeführt.
Im Übrigen wurde die unter a) dargestellte Berechnungsmethodik angewandt. 12
c) Polizeivollzugsbeamte
Bezüglich der Regelaltersgrenze wurden für die Beamten des Polizeivollzugsdienstes in Abweichung zu den Ausführungen unter a) und b) die Regelaltersgrenzen des § 106 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ThürBG sowie für Beamte, die vor dem 1. Januar 1964 geboren wurden, die Altersgrenzen des § 106 Abs. 2 und 3 ThürBG zugrunde gelegt. Aufgrund dieser besonderen Regelaltersgrenzen wird nach Information des TLF im Polizeivollzugsdienst ein möglicher Antragsruhestand (60. Lebensjahr) nach § 106 Abs. 5 ThürBG nur in Einzelfällen in Anspruch genommen. Daher wurde für die Beamten des Polizeivollzugsdienstes für den vorliegenden Bericht kein Antragsruhestand in die Berechnungen aufgenommen.
Die vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes nach § 22 ThürBeamtVG bis zum Erreichen der Altersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung wurde wie bei den Ruhestandsbeamten mit folgenden Zeiten berücksichtigt:
Tabelle Lebensalter
Hierbei wurde zudem bei der Ermittlung für jeden einzelnen Beamten beachtet, dass der nach § 22 Abs. 2 Satz 1 und 2 ThürBeamtVG berechnete erhöhte Ruhegehaltssatz einen Wert von 66,97 vom Hundert nicht überschreiten darf, § 22 Abs. 2 Satz 3 ThürBeamtVG.
Die Maßgaben der Mindestversorgung, wonach an die Stelle des Ruhegehalts 59,15 vom Hundert der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 6 treten (§ 21 Abs. 4 Sätze 2 und 3 ThürBeamtVG), sind in die Berechnungen einbezogen worden. Das bedeutet, dass für diese Beamten auf jeden Fall die Mindestversorgung berücksichtigt wurde. 13
Bezüglich des bekleideten Amtes bei Ruhestandseintritt wurde in Abweichung zu den Ausführungen unter a) für alle Beamten des mittleren Polizeivollzugsdienstes die Besoldungsgruppe A 9 angenommen. Mangels Erheblichkeit wurde auch von einem Zuschlag bei den Beamten der Besoldungsgruppe A 16 abgesehen.
Im Übrigen wurde die unter a) dargestellte Berechnungsmethodik angewandt.
d) Justizvollzugsbeamte
Für die Justizvollzugsbeamten gelten nach § 108 ThürBG die Regelaltersgrenzen des § 106 ThürBG entsprechend, so dass diese zugrunde gelegt wurden. Gleiches gilt für die Ausführungen unter c) zum Antragsruhestand.
Bezüglich des bekleideten Amtes bei Ruhestandseintritt wurde in Abweichung zu den Ausführungen unter a) in der Besoldungsordnung A für die Ämter der Besoldungsgruppe A 7 und A 8 dieses jeweils als das Amt bei Ruhestandseintritt unterstellt. Ansonsten wurden diesbezüglich die unter c) dargestellten Annahmen getroffen.
Im Übrigen wurde die unter a) dargestellte Berechnungsmethodik angewandt.
e) Ruhestandsversetzungen aufgrund von Dienstunfähigkeit
Für Ruhestandsversetzungen aufgrund von Dienstunfähigkeit können keine belastbaren Aussagen und Annahmen getroffen werden. Solche Fälle wurden daher im vorliegenden Bericht im Berichtszeitraum nicht berücksichtigt.
f) Weitere unberücksichtigt gelassene Aspekte
Die Versorgungsbezüge unterliegen beim gleichzeitigen Bezug anderer Einkünfte oder Versorgungsleistungen (z. B. Renten oder weitere Beamtenversorgung) den Ruhensregelungen nach §§ 70 ff. ThürBeamtVG. Da nicht bekannt ist, wie hoch die jeweiligen Einkünfte oder Versorgungsleistungen sind und diese auch dauerhaft Schwankungen unterliegen können, wurden sie bei den Prognosen unberücksichtigt gelassen. Sie können jedoch zu einer Verminderung der Versorgungsausgaben führen. Entsprechendes gilt für Kürzungen aufgrund eines Versorgungsausgleichs (§ 75 ThürBeamtVG) nach Ehescheidungen, wobei diesen Kürzungen in der Regel Zahlungen an die gesetzliche Rentenversicherung entgegenzurechnen sind.
Leistungen der Dienstunfallfürsorge (§§ 25 ff. ThürBeamtVG), wozu neben den Kosten des Heilverfahrens unter anderem auch die Kosten einer erhöhten Dienstunfallversorgung für den Beamten oder Richter selbst sowie für seine Hinterbliebenen gehören, wurden aufgrund der fehlenden Prognostizierbarkeit der Dienstunfälle nicht in die Berechnungen einbezogen. 14
3. Versorgungslastenteilung
Seit einigen Jahren erfolgt zwischen Bund und Ländern sowie anderen (insbesondere kommunalen) Dienstherren eine verursachungsgerechte Versorgungslastenteilung. So wird einerseits im Rahmen der Anforderung von Personalkostenerstattungen z. B. bei Abordnungen zu anderen Dienstherren ein Versorgungszuschlag erhoben. Ein Versorgungszuschlag wird ferner grundsätzlich auch dann erhoben, wenn eine Beurlaubung ohne Dienstbezüge, die öffentlichen Belangen oder dienstlichen Interessen dient, als ruhegehaltfähige Dienstzeit anerkannt werden soll (§ 13 Abs. 4 ThürBeamtVG).
Nach einem dauerhaften Dienstherrenwechsel zahlt der letzte Versorgungsdienstherr grundsätzlich die Versorgung, welche auch Beamtendienstzeiten bei früheren Dienstherren mit umfasst. Um dabei eine verursachungsgerechte Versorgungslastenteilung zu erwirken, galt in der Vergangenheit vor der Föderalismusreform der § 107b BeamtVG. Danach beteiligte sich der frühere Dienstherr an den laufend anfallenden Versorgungskosten, welche der letzte Dienstherr zu zahlen hatte. Diese laufenden Erstattungszahlungen werden auch fortgeführt, solange ein Versorgungsanspruch besteht. Bei Dienstherrenwechseln innerhalb Thüringens gilt dieses Prinzip weiter, vgl. § 83 ThürBeamtVG.
In Folge der Föderalismusreform war diese Vorgehensweise für neue Versorgungsempfänger aber nicht mehr praktikabel, so dass mit Wirkung vom 1. Januar 2011 zwischen Bund und Ländern der Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag
10 geschlossen wurde, der die frühere laufende Versorgungslastenteilung durch ein Abfindungsmodell ersetzte. Dabei wurden auch Wechselfälle, die vor dem Inkrafttreten des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages eine Versorgungslastenteilung begründet haben, in das neue System überführt, indem zum Eintritt in den Ruhestand eine Einmalzahlung des früheren, ausgleichpflichtigen Dienstherrn an den Versorgungsdienstherrn erfolgt. Bei Dienstherrenwechseln nach dem Inkrafttreten des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages erfolgt die Einmalzahlung sofort.
Prognosen für die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben der Versorgungslastenteilung können nicht getroffen werden, da zum einen die Anzahl der Dienstherrenwechsel nicht bekannt ist. Auch die individuellen Dienstzeiten oder die jeweilige Besoldungsgruppe des wechselnden Beamten, die erheblichen Einfluss auf die Höhe des Abfindungsbetrages haben, sind nicht bekannt. Da jedoch bei den vorhandenen Versorgungsempfängern, welche aus dem früheren Bundesgebiet nach Thüringen versetzt wurden, noch die laufenden Zahlungen nach § 107b BeamtVG fortgeführt werden, übersteigen die Einnahmen bei der Versorgungslastenteilung derzeit noch die Ausgaben. Im Berichtszeitraum werden sich diese laufenden Erstattungen jedoch aufgrund des Versterbens der Versorgungsempfänger und ihrer Hinterbliebenen verringern.
Tabelle
Es wird allerdings davon ausgegangen, dass sich insbesondere der Saldo der Abfindungszahlungen für neue Dienstherrenwechsel nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag mittelfristig verstetigt. Daher wurden diese Zahlungen mangels Signifikanz in den Prognosen unberücksichtigt gelassen. 4.
Altersgeld
Zum 1. November 2021 trat das Thüringer Altersgeldgesetz vom 4. Oktober 2021 11 in Kraft. Danach wird Beamten und Richtern auf Lebenszeit, die auf eigenen Antrag aus dem Beamtenverhältnis ausscheiden, anstelle der Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung ab dem Zeitpunkt des Erreichens der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung ein Altersgeld durch den Freistaat Thüringen gezahlt.
Seit dem Inkrafttreten der Regelung gibt es bereits vereinzelte Fälle, die mit einem Altersgeldanspruch das Beamtenverhältnis auf eigenen Antrag verlassen haben. Dieser Anspruch kommt zwar nicht gleich zur Auszahlung. Aufgrund der Altersstruktur der ausgeschiedenen Beamten wird es jedoch im Jahr 2028 zu einem ersten Zahlfall kommen. Weitere Zahlfälle folgen in den darauffolgenden Jahren.
Bei den Prognosen für die Beamtenversorgung wurden das mögliche Ausscheiden von Beamten auf eigenen Wunsch unberücksichtigt gelassen. Diese Beamten verlieren durch das Ausscheiden jedoch ihren Anspruch auf Beamtenversorgung und erhalten stattdessen einen Anspruch auf Altersgeld. Bezüglich der zu erwartenden Ausgaben kann daher in der Gesamtschau die Zahlung des Altersgeldes unberücksichtigt bleiben. 11
GVBl. S. 508.
16
III. Ergebnisse der Berechnung
Anhand der unter II. dargestellten Berechnungsgrundlagen, der Berechnungsmethodik und der für die Berechnung getroffene Annahmen sind für den Berichtszeitraum die nachfolgenden Prognosen erstellt worden. Diese beziehen sich zum einen auf die Entwicklung der Anzahl der Versorgungsempfänger und zum anderen auf die Entwicklung der Versorgungsausgaben.
1. Entwicklung der Anzahl der Versorgungsempfänger
Die Entwicklung der Anzahl der Versorgungsempfänger stellt sich in graphischer und tabellarischer Form wie folgt dar: 05.00010.00015.00020.00025.00030.000AnzahlJahrEntwicklung der Anzahl der VersorgungsempfängerVersorungsempfänger (einschließlich Witwen und Waisen) insgesamtdavon Bestand zum 1. Januar 2023davon im jeweiligen Jahr Hinzutretende 17
Tabelle Jahr
2.
Entwicklung der Versorgungsausgaben
Die Entwicklung der Versorgungsausgaben im Berichtszeitraum ist determiniert von den Besoldungsanpassungen, welche aufgrund von § 4 Abs. 1 ThürBeamtVG zeitgleich auf die Versorgungsempfänger übertragen werden müssen. Um diese Abhängigkeit aufzuzeigen, wurden drei Szenarien erstellt, die eine unterschiedliche Entwicklung der Besoldungsanpassungen simulieren:
Szenario I:
keine Besoldungsanpassung im Berichtszeitraum: das Szenario soll lediglich die strukturellen Einflüsse der Zahl der Ruhegehaltsempfänger sowie deren Alter und ruhegehaltfähige Dienstzeit verdeutlichen.
Szenario II:
jährliche Anpassung der Bezüge um 2 Prozent
Szenario III:
jährliche Anpassung der Bezüge um 3 Prozent
18
Die Ergebnisse der Szenariobetrachtungen lassen sich graphisch wie folgt darstellen:
0100.000.000200.000.000300.000.000400.000.000500.000.000600.000.000700.000.000800.000.000900.000.0001.000.000.000Versorgungsausgaben in EuroJahrprognostizierte Versorgungsausgaben (Szenario I)0200.000.000400.000.000600.000.000800.000.0001.000.000.0001.200.000.0001.400.000.000Versorgungsausgaben in EuroJahrprognostizierte Versorgungsausgaben (Szenario II)
19
Ein Vergleich der drei Szenarien ergibt folgendes Bild: 0200.000.000400.000.000600.000.000800.000.0001.000.000.0001.200.000.0001.400.000.0001.600.000.000Versorgungsausgaben in EuroJahrprognostizierte Versorgungsausgaben (Szenario III)0200.000.000400.000.000600.000.000800.000.0001.000.000.0001.200.000.0001.400.000.0001.600.000.000Versorgungsausgaben in EuroJahrVergleich der SzenarienSzenario ISzenario IISzenario III 20
In tabellarischer Form stellen sich die Szenariobetrachtungen wie folgt dar:
Tabelle Jahr
Hieraus ist zu entnehmen, dass im Szenario I im Berichtszeitraum die Versorgungsausgaben ab dem Jahr 2023 monoton steigen und im Jahr 2038 ein Maximum erreichen. Ferner ist hieraus abzuleiten, dass sich die Versorgungsausgaben allein aufgrund struktureller Einflüsse bis zum Jahr 2038 im Vergleich zum Jahr 2023 verdoppeln und dann bis zum Jahr 2042 auf das 1,89-fache sinken werden.
Sowohl im Szenario II als auch im Szenario III wird hingegen im Berichtszeitraum kein Maximum erreicht. Aufgrund des sich vermindernden Anstiegs der Kurven bis zum Jahr 2042 ist ein solches allerdings außerhalb des Berichtszeitraums zu erwarten. Bis zum Ende des Berichtszeitraums werden die Versorgungsausgaben im Vergleich zum Jahr 2023 um das 2,76fache (Szenario II) bzw. um das 3,32fache (Szenario III) steigen. 21
Schlussendlich verhalten sich die Versorgungsausgaben in den drei Szenarien im Jahr 2042 wie 1 : 1,46 : 1,75.
IV. Bewertung
Die Personalausgaben bilden derzeit mit mehr als einem Viertel des Gesamthaushaltsvolumens einen wesentlichen Teil der Landesausgaben und werden auch in Zukunft eine weiterhin deutlich ansteigende Tendenz aufzeigen. Insbesondere die Tarifabschlüsse, die Auswirkungen der Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation, aber auch die steigende Versorgungsausgaben werden diesen Effekt forcieren. Allein im Haushaltsjahr 2022 hat dabei der Anteil der Versorgungsausgaben für Beamte und Richter sowie deren Hinterbliebenen bereits mehr als 11 vom Hundert der vom Freistaat zu schulternden Personalausgaben erreicht. Dieser Anteil wird im Berichtszeitraum deutlich steigen.
Mit dem Thüringer Gesetz zur finanzpolitischen Vorsorge für die Beamtenversorgung 12 vom 20. Februar 2018 wurde ab dem Haushaltsjahr 2018 erstmals die gesetzlich fixierte, regelgebundene Tilgung durch das Thüringer Nachhaltigkeitsmodell aufgenommen. Danach wird für jeden ab dem Haushaltsjahr 2017 neu verbeamteten Bediensteten eine Pauschale in Höhe von 5.500 Euro jährlich zur Tilgung der im Kernhaushalt bestehenden Landesschulden eingesetzt. Zusätzlich erfolgt jährlich eine sogenannte Basistilgung in Höhe von 30,1 Mio. Euro.
Mit dem Abbau der Schulden und der damit einhergehenden Reduzierung der Zinslast im Landeshaushalt kann langfristig das künftige Anwachsen der Versorgungsausgaben im Landeshaushalt zumindest teilweise kompensiert werden. Damit wird finanzpolitische Vorsorge getroffen, um den zukünftigen Pensionsausgaben besser Rechnung zu tragen. Um diesem Ziel nachzukommen, wird die Tilgung nach dem Nachhaltigkeitsmodell auch nicht auf die Tilgung der „Corona-Verschuldung“ angerechnet, sondern tritt dieser hinzu.
Das Thüringer Nachhaltigkeitsmodell wird auch in den kommenden Jahren zu weiter steigenden Tilgungsleistungen führen. Nach einer zwischenzeitlichen Tilgungsaussetzung in den Jahren 2020 und 2021 – aufgrund der in der Haushaltsplanung vorgesehenen Kreditaufnahme – wurde im Haushaltsjahr 2022 die planmäßige Tilgung wieder aufgenommen. Wurden im Haushaltsjahr 2022 bereits 70,2 Mio. Euro im Rahmen des Thüringer Nachhaltigkeitsmodells getilgt, werden im Jahr 2032 eine Tilgung in Höhe von 142 Mio. Euro und im Jahr 2042 eine Tilgung in Höhe von ca. 213 Mio. Euro erwartet. Insgesamt werden sich im Rahmen des Thüringer Nachhaltigkeitsmodells bis zum Haushaltsjahr 2042 dann die Landesschulden um ca. 3,1 Milliarden Euro reduzieren. Damit würde allein im Haushaltsjahr 2042 eine Zinsentlastung von 78 Mio. Euro (bei einem Kalkulationszinssatz in Höhe von 2,5 vom Hundert p. a.) für den 12 GVBl. S. 12. 22 Thüringer Landeshaushalt einhergehen. Diese Einsparungen stehen dann auch zur Abfederung der künftigen Versorgungsausgaben zur Verfügung. Gleiches gilt für die insgesamt in den Jahren 2018 bis 2042 aus dem Thüringer Nachhaltigkeitsmodell erwartete Zinsentlastung von über 660 Mio. Euro.
Im Hinblick auf die Regelung in Art. 98 Abs. 3 Thüringer Verfassung, wonach die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Personalausgaben grundsätzlich höchstens 40 vom Hundert der Summe der Gesamtausgaben des Haushalts betragen darf, kann das Nachhaltigkeitsmodell nur ein Aspekt künftiger Haushaltspolitik sein.
Die Entwicklung der Versorgungsausgaben ist strukturell bedingt und wird sowohl von der Verbeamtungspolitik in der Vergangenheit als auch durch die Entscheidungen zur Verbeamtung für die Zukunft beeinflusst. Sie ist im Hinblick auf die Verbeamtungen in der Vergangenheit grundsätzlich nicht abänderbar. Beeinflussbar im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben im Besoldungs- und Versorgungsrecht ist die zukünftige Entwicklung der Versorgungsausgaben damit lediglich durch die Zahl der Neueinstellungen bzw. Neuernennung von Beamten sowie - unter Beachtung der Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation - durch die Höhe der Bezügeanpassungen.
Mit Blick auf die Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation sind dem gesetzgeberischen Handlungsspielraum nicht erst durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 13 vom 4. Mai 2020 enge Grenzen gesetzt worden. Das Gericht führt jüngst in diesem Beschluss aus, dass der Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation Teil der mit den hergebrachten Grundsätzen verbundenen institutionellen Garantie des Art. 33 Abs. 5 GG ist. Soweit er mit anderen verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen oder Instituten kollidiert, ist er entsprechend dem Grundsatz der praktischen Konkordanz im Wege der Abwägung zu einem schonenden Ausgleich zu bringen. Verfassungsrang hat diesbezüglich namentlich das Verbot der Neuverschuldung in Art. 109 Abs. 3 Satz 1 GG. Danach sind Haushalte von Bund und Ländern grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen (sogenannte Schuldenbremse). Ausnahmsweise ist eine Neuverschuldung bei konjunkturellen Abweichungen von der Normallage (vgl. Art. 109 Abs. 3 Satz 2 Variante 1 GG) sowie bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen zulässig (vgl. Art. 109 Abs. 3 Satz 2 Variante 2 GG). Ungeachtet der Verschärfung der Regeln für die Kreditaufnahme durch die Neufassung des Art. 109 Abs. 3 GG vermögen nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts indes allein die Finanzlage der öffentlichen Haushalte oder das Ziel der Haushaltskonsolidierung den Grundsatz der amtsangemessenen Alimentierung nicht einzuschränken.
14 Andernfalls liefe die Schutzfunktion des Art. 33 Abs. 5 GG ins Leere. Auch das besondere Treueverhältnis verpflichtet Richter und Staatsanwälte nicht dazu, stärker als andere zur Konsolidierung öffentlicher 13 BVerfG, Beschl. v. 4. Mai 2020, Az.: 2 BvL 4/18 Rn. 92 – juris. 14 BVerfG, Beschl. v. 4. Mai 2020, Az.: 2 BvL 4/18 Rn. 94 – juris. 23
Haushalte beizutragen. Eine Einschränkung des Grundsatzes der amtsangemessenen Alimentierung aus rein finanziellen Gründen kann zur Bewältigung einer der in Art. 109 Abs. 3 Satz 2 GG genannten Ausnahmesituationen jedoch in Ansatz gebracht werden, wenn die betreffende gesetzgeberische Maßnahme Teil eines schlüssigen und umfassenden Konzepts der Haushaltskonsolidierung ist, das anhand einer aussagekräftigen Begründung in den Gesetzgebungsmaterialien – gegebenenfalls unter ergänzender Heranziehung der im Rahmen eines Konsolidierungs- oder Sanierungshilfeverfahrens getroffenen Vereinbarungen – erkennbar sein muss. Ein solches Konzept setzt inhaltlich wenigstens die Definition eines angestrebten Sparziels sowie die nachvollziehbare Auswahl der zu dessen Erreichung erforderlichen Maßnahmen voraus. Vor dem Hintergrund der Wertungen des Art. 3 Abs. 1 GG ist das notwendige Sparvolumen dabei gleichheitsgerecht zu erwirtschaften.
Jenseits des verfassungsrechtlich gebotenen Mindestmaßes, wie es sich aufgrund der oben dargestellten Gesamtschau ergibt, genießt die Alimentation einen relativen Normbestandsschutz.
15 Der Gesetzgeber darf hier Kürzungen oder andere Einschnitte in die Bezüge vornehmen, wenn dies aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist. Kürzungen oder andere Einschnitte können durch solche Gründe sachlich gerechtfertigt werden, die im Bereich des Systems der Beamtenbesoldung liegen. Zu solchen systemimmanenten Gründen können finanzielle Erwägungen zwar hinzutreten; das Bemühen, Ausgaben zu sparen, kann aber nicht als ausreichende Legitimation für eine Kürzung der Besoldung angesehen werden, soweit sie nicht als Teil eines schlüssigen Gesamtkonzepts dem in Art. 109 Abs. 3 GG verankerten Ziel der Haushaltskonsolidierung dient.
Entsprechende Maßgaben und Grundsätze wurden bereits in früherer Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts speziell zur Beamtenversorgung ausgeführt. Hierbei wird insbesondere auf die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vom 27. September 2005 16 und vom 20. März 2007 17 verwiesen.
So führt das Bundesverfassungsgericht auch in dem Beschluss vom 27. September 2005 aus 18: „Die steigenden Ausgaben der Beamtenversorgung, mit denen der Gesetzgeber die Absenkung des Versorgungsniveaus begründet hat (vgl. BTDrucks 14/7064, S. 30), stellen keinen sachlichen Grund für die Verminderung der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und des Versorgungssatzes dar. 15 BVerfG, Beschl. v. 4. Mai 2020, Az.: 2 BvL 4/18 Rn. 95 – juris.
16 BVerfG, Urt. v. 27. September 2005, Az.: 2 BVR 1387/02 – juris. 17 BVerfG, Beschl. v. 20. März 2007, Az: 2 BvL 11/04 – juris. 18 BVerfG, Urt. v. 27. September 2005, Az.: 2 BVR 1387/02 Rn. 121 f. – juris.
24
(1) Im Beamtenrecht können finanzielle Erwägungen und das Bemühen, Ausgaben zu sparen, in aller Regel für sich genommen nicht als ausreichende Legitimation für eine Kürzung der Altersversorgung angesehen werden. Die vom Dienstherrn geschuldete Alimentierung ist keine dem Umfang nach beliebig variable Größe, die sich einfach nach den wirtschaftlichen Möglichkeiten der öffentlichen Hand, nach politischen Dringlichkeitsbewertungen oder nach dem Umfang der Bemühungen um die Verwirklichung des allgemeinen Sozialstaatsprinzips bemessen lässt (vgl. BVerfGE 44, 249 ; 99, 300 ). Alimentation des Beamten und seiner Familie ist etwas anderes und Eindeutigeres als staatliche Hilfe zur Erhaltung eines Mindestmaßes sozialer Sicherung und eines sozialen Standards für alle und findet seinen Rechtsgrund nicht im Sozialstaatsprinzip, sondern in Art. 33 Abs. 5 GG (vgl. BVerfGE 44, 249 ; 81, 363 ). Zu den finanziellen Erwägungen müssen deshalb in aller Regel weitere Gründe hinzukommen, die im Bereich des Systems der Altersversorgung liegen und die Kürzung von Versorgungsbezügen als sachlich gerechtfertigt erscheinen lassen (vgl. BVerfGE 76, 256 ).“
Damit ist ersichtlich, dass das Bundesverfassungsgericht in Bezug auf die Alimentation gesetzliche Änderungen zu Lasten der Beamten, Richter und Versorgungsempfänger lediglich in den vorbenannten eng begrenzten Ausnahmefällen zulässt.
|
Urlaub und Freizeit in den schönsten Regionen und Städten von Deutschland, z.B. Thüringen Sehnsucht nach Urlaub und dem richtigen Urlaubsquartier, ganz gleich ob Hotel, Gasthof, Pension, Appartement, Bauernhof, Reiterhof oder sonstige Unterkunft. Die Website www.urlaubsverzeichnis-online.de bietet mehr als 6.000 Gastgeber in Deutschland, Österreich, Schweiz oder Italien, u.a. auch Gastgeber aus dem Wanderparadies und Biathlongebiet in Thüringen. Die wunderbare Stadt Weimar mit den Bauwerken: Weimarer Rathaus, Weimarer Stadthaus, Renaissance-Bauten der Markt-Ostseite, u. a. mit dem Cranachhaus, Geleitschenke, historische Gastwirtschaft und eines der schönsten Fachwerkhäuser in Weimar, Goethes Wohnhaus mit Goethe-Nationalmuseum, Schillers Wohnhaus mit Schillermuseum, Goethe- und Schiller-Denkmal, Park an der Ilm mit Goethes Gartenhaus, Römischem Haus und Parkhöhle und den Historischer Friedhof mit Fürstengruft und Russisch-Orthodoxer Grabkapelle. Aber auch die Landeshauptstadt Erfurt ist ein Besuch wert (unverzichtbar ist die Krämerbrücke). Besonders schön zur Weihnachtszeit, der tolle Weihnachtsmarkt. |
Red 20231231